Gottesdienste aktuell
Gottesdienste in Roding, Trasching (T), Obertrübenbach (O), Wetterfeld (W), Heilbrünnl (HB) und Caritas-Altenheim (CA)
Sa./So.10./11.01. Fest Taufe des Herrn
Bei den Gottesdiensten erneuern die Erstkommunionkinder ihr Taufversprechen!
15.30 Uhr T Rosenkranz
16.00 Uhr T Vorabendmesse
17.00 Uhr bis 17.30 Uhr Beichtgelegenheit
17.30 Uhr Wir beten den Rosenkranz
18.00 Uhr Vorabendmesse
8.00 Uhr Pfarrgottesdienst
9.00 Uhr O Hl. Messe
11.15 Uhr O Tauffeier
10.00 Uhr Hl. Messe
11.15 Uhr Tauffeier
15.00 Uhr Taufgedächtnisgottesdienst für die Täuflinge 2025
18.00 Uhr W Hl. Messe
Mo. 12.01. der 1. Woche im Jahreskreis
18.20 Uhr Rosenkranz
19.00 Uhr Hl. Messe
Di. 13.01. Gedenktag Hl. Hilarius
8.00 Uhr Morgenlob mit anschl. Frauenfrühstück
10.00 Uhr CA Hl. Messe
18.30 Uhr O Fatimarosenkranz
19.00 Uhr O Hl. Messe
18.30 Uhr T Fatimarosenkranz
19.00 Uhr Fatimarosenkranz
Mi. 14.01. der 1. Woche im Jahreskreis
10.00 Uhr KH Hl. Messe
16.30 Uhr T Rosenkranz
17.00 Uhr T Hl. Messe
Do. 15.01. der 1. Woche im Jahreskreis
16.30 Uhr CA Hl. Messe
18.30 Uhr W Fatimarosenkranz
19.00 Uhr W Hl. Messe
Fr. 16.01. der 1. Woche im Jahreskreis
8.00 Uhr Hl. Messe
Sa./So. 17./18.01. 2. Sonntag im Jahreskreis
15.30 Uhr T Rosenkranz
16.00 Uhr T Vorabendmesse
17.00 Uhr bis 17.30 Uhr Beichtgelegenheit
17.30 Uhr Wir beten den Rosenkranz
18.00 Uhr Vorabendmesse mit den Ehejubilaren
8.00 Uhr Pfarrgottesdienst
10.00 Uhr Hl. Messe Stadt Roding zu Ehren des Heiligen Sebastian
Nach dem Gottesdienst Prozession zur Sebastianikapelle
Fürbittgebet
14.30 Uhr Kirchenführung
18.00 Uhr W Hl. Messe
In eigener Sache
Inzwischen haben viele unseren Pfarrbrief abonniert. Leider kommt es immer wieder vor, dass die Mail als unzustellbar oder "Error" zurückkommt, obwohl die Adresse nachweislich richtig war. Wir haben dann keine Möglichkeit, keinen funktionierenden Kontakt, um darauf aufmerksam zu machen - erst wenn nach einiger Zeit Beschwerde eintrifft, warum der Pfarrbrief nicht (mehr) kommt. Bitte leeren Sie regelmäßig Ihr e-Postfach oder schauen auch mal im SPAM Ordner nach, wenn der Pfarrbrief nicht zugestellt wurde. Danke!
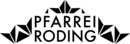
 MENÜ
MENÜ